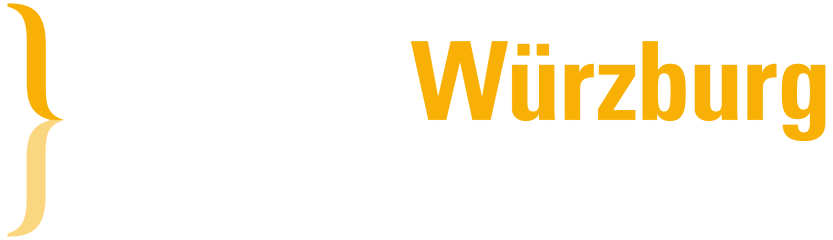„Was wäre das Schlimmste, das mir als Berufsanfängerin passieren kann?“ Das war eine von vielen Fragen, die beim Bewerberkreiswochenende des Fachbereichs Gemeindereferenten im Exerzitienhaus Himmelspforten gestellt wurden. Die elf Teilnehmer gehören zu den insgesamt 18 Menschen zwischen 19 und 49 Jahren, die sich zurzeit für die Diözese Würzburg auf dem Weg zum Beruf des Gemeindereferenten sind. Manche stehen noch ganz am Anfang, andere haben das Religionspädagogik-Studium bald hinter sich und werden dann in einer Pfarrgemeinde mit der Assistenzzeit beginnen. „Nicht ernst genommen werden“, war eines der Dinge, die sie für ihren Start befürchten. Aber auch „Was ist, wenn die Teamarbeit vor Ort nicht klappt?“ und „Wissen die Menschen, dass wir keine Ersatzpfarrer sind?“, wurde formuliert. Außerdem berichteten die Studenten auch von der Burnout-Gefahr in pastoralen Berufen, von der sie gehört hätten.
Solchen Ängsten entgegentreten ist eines der Ziele, die Ausbildungsleiterin Cornelia Weiser bei diesen Treffen mit dem pastoralen Nachwuchs verfolgte. Sie hatte neben Berufsgruppensprecherin Julia Butz noch weitere Kollegen eingeladen, die von ihren Erfahrungen im Dienst der Diözese berichteten. Die jungen Leute bekamen Tipps für den Start in den Beruf, Einblicke in den Alltag der Pastoral und hörten, wie andere es beispielsweise schaffen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Als wichtig bezeichnete Weiser auch, dass die Studierenden sich untereinander kennenlernen.
Anders als die Theologiestudenten sind sie in der Ausbildung auf vier verschiedenen Lehrstätten verteilt. Manche haben direkt nach Schule und Freiwilligem Sozialem Jahr das Studium in Mainz oder Eichstätt begonnen, andere haben schon einen Beruf erlernt und gehen jetzt auf die Fachakademie in Freiburg oder absolvieren den Würzburger Fernkurs für Theologie. Doch so unterschiedlich die Vorerfahrungen sind, so sehr ähneln sich die Motivationen, mit denen die Teilnehmer ihr Interesse am Beruf des Gemeindereferenten begründen. „Ich hatte schon immer den Gedanken, irgendetwas zu machen, das mit Menschen zu tun hat“, sagte beispielweise die 20-jährige Theresa Schwab aus Leinach, die in Eichstätt im dritten Semester studiert. Positive Erfahrungen bei ihrem Engagement als Ministrantin und ein Gespräch mit ihrem Heimatpfarrer hätten sie auf den Gedanken gebracht, diesem Wunsch im Rahmen eines Berufes in der Kirche nachzugehen.
Laut Weiser, seit über 15 Jahren diözesane Ausbildungsleiterin für die Bewerber bis zum Eintritt in die Assistenzzeit, hat sich der Berufsnachwuchs verändert. Es seien nicht nur deutlich weniger Menschen geworden, die sich für einen kirchlichen Beruf interessieren. „Früher hatten wir auch sehr viel mehr Bewerber mit handfesten ehrenamtlichen Erfahrungen in der Pfarreiarbeit vor Ort“, erklärte sie. Inzwischen gebe es auch richtige Quereinsteiger, die beispielsweise erst über das Internet vom Beruf des Gemeindereferenten erfahren hätten. Nach einem starken Einbruch der Bewerberzahlen vor etwa zehn Jahren hätten diese sich jetzt wieder stabilisiert. In den nächsten Jahren könnten wohl im Schnitt drei bis vier Gemeindereferenten pro Jahr angestellt werden. Das reiche aber gerade, um die um die Zahl der momentan 140 Gemeindereferenten in der Diözese in etwa zu halten, erklärte die Ausbildungsreferentin. Der Bedarf sei aber höher, freie Stellen gäbe es in der Diözese genügend.
Nicht nur die Bewerber, auch die Gesellschaft hat sich geändert, und deshalb ist für so manchen die Arbeit bei der Institution Kirche nicht immer naheliegend. Der 21-jährige Dominik Schaack aus Alzenau hat zunächst Heilerziehungspfleger gelernt und erinnert sich noch gut an die Einstellungen seiner früheren Kollegen zur Institution Kirche. „Mir ist es schwer gefallen, den anderen zu erzählen, dass ich jetzt Religionspädagogik studiere und dann bei der Kirche arbeite“, sagte Schaack. Mittlerweile kommuniziere er es ganz offen, aber habe festgestellt, dass die Reaktionen darauf nicht immer schön seien. Ziel der Kritik von außen sei aber in den meisten Fällen nicht die Pfarrgemeinde vor Ort, sondern die Institution Kirche. Der 33-jährige Marktheidenfelder Christof Brod absolvierte zunächst eine Berufsausbildung zum Finanzbuchhalter und lebte danach kurz im Kloster Münsterschwarzach. Im Herbst beginnt er zusammen mit Schaack an der Fachakademie in Freiburg sein Studium. Wenn er das Wort „Kirche“ höre, habe er für sich ganz klar: „Ich denke in erster Linie an die Menschen in der Gemeinde, wenn ich an meine zukünftige Aufgabe denken, nicht an die Institution.“ Neben den kritischen Stimmen, die es auch bei ihm gegeben habe, sei er nach seiner Entscheidung für einen Weg in der Kirche oft auch sehr schnell zum Ansprechpartner für Lebens- und Glaubensfragen geworden. „Da ist dann plötzlich auch sehr viel Vertrauen da“, hat er festgestellt.
Als Motivation für die Arbeit als Gemeindereferent sprachen die Bewerber in der Regel sehr schnell von der Vielfalt des Arbeitsfeldes. Die Aufgaben der Gemeindereferenten reichen von Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur Familien- und Seniorenseelsorge, der Liturgie, in der Bildungsarbeit und dem Religionsunterricht. Als bereichernd nannten die meisten der Teilnehmer des Wochenendes, dass auch ihre persönlichen Stärken einen Platz hätten bei der Seelsorgearbeit. Schließlich sei das wichtigste Arbeitsmittel bei der Begleitung von Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg die eigene Persönlichkeit.
„Deswegen besteht die Begleitung der angehenden Gemeindereferenten durch das Ausbildungsreferat der Diözese zu großen Teilen auch aus Persönlichkeitsbildung. Sie ergänzt die Mischung aus theologischen, pädagogischen und psychologischen Fächern und Praktika, mit denen sich die Studierenden an den verschiedenen Ausbildungsstätten auseinandersetzen“, erklärte Weiser. Brod, der ja schon auf Erfahrungen im Kloster Münsterschwarzach zurück schauen kann, formuliert es so: „Der größte Wunsch, den man hat, ist, dass einem jemand genau sagt, was zu tun ist. Aber das gibt es bei diesem Beruf nicht, man muss seinen eigenen Weg finden.“